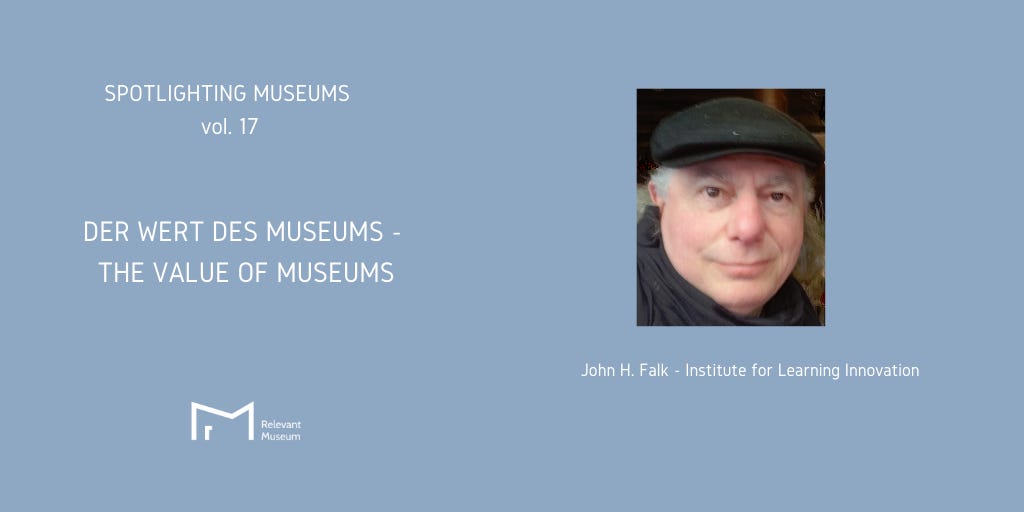Please find the English version below
Willkommen zu unserer neusten Ausgabe, die wir der transformativen Kraft des Museums widmen.
Was haben Sie bei Ihrem letzten Museumsbesuch erlebt? Was blieb Ihnen besonders von dieser Erfahrung in Erinnerung? Welchen konkreten Wert würden Sie dieser beimessen?
Einer, der sich seit Jahrzehnten intensiv mit nutzerzentrierten Fragen wie diesen annimmt und zahlreiche Veröffentlichungen dazu vorlegt, ist John H. Falk, Gründer des „Institute for Learning Innovation“ in Oregon.
In Zusammenarbeit mit ihm findet alle zwei Jahre die Tagung „Connected Audience“ in Europa statt, die sich an Museumsexpertinnen und Museumsexperten in Forschung, Praxis und Kulturpolitik richtet. Zuletzt fand sie virtuell in Kooperation mit dem „Institut für Kulturelle Teilhabeforschung”, Berlin, statt und widmete sich drängenden Fragen von Gemeinwohlorientierung und Relevanz von Museen.
John H. Falk stellte seine jüngste Publikation „The Value of Museums: Enhancing Societal Well-Being” (2022) vor, in der er den Wert und den langfristigen Effekt eines Museumsbesuchs beleuchtet.
Wir kamen mit John ins Gespräch. Heute erläutert er für uns seine Grundannahmen und die damit verknüpfte Pilotstudie.
F. – Wie profitieren Museumsbesucher von ihrem Museumsbesuch?
A. – Museen haben lange sowohl geglaubt als auch für sich beansprucht, dass Besucherinnen und Besucher einen erheblichen Mehrwert durch ihren Aufenthalt erlangen. Es war jedoch schon immer eine Herausforderung, diese Grundannahme anhand von Praxisbeispielen nachzuweisen. In den letzten Jahren habe ich versucht, einen vertretbaren, empirisch fundierten Weg für Museen zu finden, um diese These zu unterfüttern.
Insbesondere nach der Durchsicht von Ergebnissen der Besucherforschung der letzten fünfzig Jahre sowie der Durchführung zusätzlicher Studien kann ich bestätigen, dass Museen tatsächlich einen erheblichen Mehrwert für ihre Nutzer schaffen.
Millionen von Menschen besuchen Museen in der Erwartung, dass es sie bereichert - all diese Menschen irren sich nicht. Dabei sticht heraus, dass die meisten Besucher berichten, dass Zufriedenheit und Erfüllung durch ihre Museumserlebnisse nicht nur Stunden, sondern oft Wochen, Monate und in einigen Fällen Jahrzehnte andauerten.
Dies spiegelt sich in vier Kategorien wider:
Persönlich – Museen erwecken Erstaunen, Interesse und Neugier. Sie fördern auch ein intensiveres Gefühl der persönlichen Verbundenheit, Wertschätzung, Zugehörigkeit und Harmonie mit Mensch und Umwelt. Museen bieten Gelegenheiten, die Identität und ein größeres Bewusstsein der eigenen Sinnhaftigkeit zu stärken.
Intellektuell – Museen verhelfen Menschen zu mehr Klarheit, wie vergangene Erkenntnisse und Geschichte miteinander verbunden sind. Sie steigern die Wertschätzung für das Beste der menschlichen und natürlichen Schöpfung und dienen im besten Fall sogar als Wegweiser für eine bessere, aufgeklärtere und kreativere Zukunft.
Sozial - Museen verbessern das Zugehörigkeitsgefühl zur Familie, einer Gruppe oder Gemeinschaft und verstärken Hilfsbereitschaft. Als anerkannte Institutionen verleihen Museen ihren Nutzern ein gewisses Maß an Ansehen und Respekt.
Physisch – Museen werden (zumindest historisch) als sichere, vitale und erholsame Umgebung wahrgenommen, die es den Menschen ermöglichen, sich (physisch oder virtuell) zu versammeln, zu interagieren, zu erkunden, zu spielen und zu genießen, ohne jegliche Sorge oder Angst.
Museumsbesucher sind nicht die einzigen, die Erfahrungen auf diesen vier Ebenen suchen und natürlich sind Museen nicht die einzigen öffentlichen Einrichtungen, die in der Lage sind, diese Art von Mehrwert zu schaffen.
Für viele wird das Museumserlebnis gerade deshalb zu einem wertvollen Beitrag zu einem gesunden Leben, weil es sowohl auf persönlicher, intellektueller, sozialer und körperlicher Ebene stärkt.”
F. – Sie bezeichnen den Wert als eine Form des gesteigerten Wohlbefindens. Können Sie uns helfen, besser zu verstehen, was Sie unter Wohlbefinden (oder Well-Being) verstehen?
A. – „Gute Frage, ich definiere Wohlbefinden aus einer evolutionären Perspektive. Biologisch gesehen bezieht sich Wohlbefinden auf das kontinuierliche Streben nach Balance. In Balance zu sein fühlt sich gut an, d.h. ist erfüllend. Aus dem Gleichgewicht zu geraten fühlt sich schlecht an, d.h. ist unbefriedigend.
Der Wunsch nach Wohlbefinden ist sowohl grundlegend als auch universell, etwas, wonach jeder Mensch in jeder kulturellen Gruppe, in jeder Ecke des Planeten strebt. Natürlich hat jede Kultur dieses Streben nach Wohlbefinden anders gesehen und beschrieben, aber jede hat auf ihre Weise den grundlegenden Wunsch nach Wohlbefinden in ihre Philosophien und ihr tägliches Leben integriert.
Trotz der Allgegenwart dieser Ideen und Bestrebungen im Zusammenhang mit dem Wohlbefinden in allen Weltkulturen ist es eine überraschende Erkenntnis, wie wenig das Wesen von Wohlbefinden durch Wissenschaftler definiert und untersucht wurde.
Am problematischsten ist dabei, dass die meisten Forscher Wohlbefinden als ein rein menschliches, psychologisches Phänomen und noch problematischer als Synonym für Glück oder Wohlstand zu betrachten scheinen.
Obwohl Glück und Wohlstand Zeichen des Wohlbefindens sein können, umfassen beide nicht ausreichend die wahre Tiefe und Bedeutung des Wohlbefindens. Die Fähigkeit, auf eine Weise wahrzunehmen und zu handeln, die das Wohlbefinden verbessert, ist eigentlich keine neuere menschliche Erfindung, sondern eine uralte und allgegenwärtige evolutionäre Überlebensstrategie.
Menschen versuchen ständig, auf eine Weise zu handeln, die ihr positives Wohlbefinden maximiert und ihr negatives Befinden minimiert, da das Gleichgewicht positiv mit der langfristigen evolutionären Fitness korreliert.
Lebewesen, die in der Lage sind, dieses Gleichgewicht positiv zu beeinflussen, sind im Durchschnitt biologisch und im Falle des Menschen auch kulturell erfolgreicher.
Daher ist es nicht verwunderlich, dass Menschen beim Rückblick auf ihre Museumserlebnisse, Tage, Wochen und sogar Jahre später, ihre Beschreibungen des Mehrwerts, den sie wie oben beschrieben haben, in diese vier grundlegenden Bereiche des menschlichen Wohlbefindens einsortieren.
Tatsächlich überraschend ist jedoch, dass Museumsfachleute diese Tatsache historisch gesehen nicht vollständig erkannt haben und daher nicht in der Lage waren, aus dieser Erkenntnis umfassend Kapital zu schlagen. Das ändert sich nun.”
F. – Wie können diese Ideen von Museen genutzt werden?
A. – „Diese Ideen sowie die generierten Daten, die diese Ideen unterstützen, ermöglichen es Museumsexperten, ihre Praxis auf drei essentielle Weisen zu verbessern:
1) Den grundlegenden Wert, den Museen für die Öffentlichkeit schaffen, effektiver zu beschreiben und zu verteidigen
2) Die Wirksamkeit verschiedener Museumserlebnisse, unabhängig von Disziplin, Inhalt und Herangehensweise direkt vergleichen und bewerten zu können
3) Noch bessere, effektivere Museumserlebnisse für die Öffentlichkeit entwickeln zu können
Indem sie die Vorteile von Museumserfahrungen in Bezug auf universelle, auf Wohlbefinden bezogene menschliche Bedürfnisse und Bestrebungen formulieren, sollte die Museumsleitung in der Lage sein, erfolgreicher zu argumentieren, dass Museen mit angemessener Unterstützung das Potenzial haben, das Gemeinwohl zu stärken, und nicht nur die esoterischen Bedürfnisse einiger weniger.
Darüber hinaus kann die Museumsleitung durch monetäre Begriffe, die Vorteile von Museumserfahrungen nicht nur in der Sprache der politischen Entscheidungsträger, des Geldes, beschreiben, sondern den äußerst kostengünstig erschaffenen Mehrwert von Museumserlebnissen aufzeigen.
Denn der von Museumserfahrungen generierte Geldwert übersteigt bei weitem die Entwicklungskosten.
Zweitens werden Direktorinnen und Direktoren durch die Schaffung einer Wertemetrik – des verbesserten Wohlbefindens - in der Lage sein, die tatsächlichen Kosten und den öffentlichen Nutzen ihrer verschiedenen Angebote direkt und objektiv zu vergleichen und gegenüberzustellen.
Dabei sind sie unabhängig vom spezifischen Inhalt, z. B. Kunst, Wissenschaft oder Geschichte, der Konzeption eines Erlebnisses, z. B. Ausstellung oder Programm, live oder virtuell.
Schließlich hat diese Neukontextualisierung des Wertekonzeptes von Museumserlebnissen das Potenzial, Museumspraktiker deutlich besser zu befähigen, effiziente Museumserlebnisse zu entwerfen und umzusetzen. Im Zentrum dieses Potenzials steht die Erkenntnis, dass Ausstellungen, Objekte, Programme, Filme, Websites etc. nur Mittel zum Zweck sind.
Der wahre Wert von Museumserlebnissen liegt darin, wie und von wem sie genutzt werden.
Das eigentliche Ziel von Museen ist es, das gesellschaftliche Gemeinwohl zu verbessern.
Am wichtigsten ist vielleicht, dass diese neuen Erkenntnisse Möglichkeiten und Gelegenheiten schaffen, den Bedürfnissen eines zunehmend größeren Teils der Öffentlichkeit zu entsprechen, einschließlich und ausdrücklich derjenigen, die sozial und wirtschaftlich weniger privilegiert sind.”
Mehr Informationen hier:
John H. Falk (2022). The Value of Museums: Enhancing Societal Well-Being
Direkter Kontakt zu John hier:
john.falk@freechoicelearning.org
Teilen Sie gern Ihre Meinung und Erfahrungen mit uns. Wir freuen uns auf den Austausch.
Herzliche Grüße aus der NORDMETALL-Stiftung
Katja
English version
Welcome to our latest issue, dedicated to the transformative power of museums.
What did you experience during your last visit to the museum? What do you remember most about this experience? What concrete value would you attach to this?
John H. Falk, founder of the “Institute for Learning Innovation” in Oregon, is an expert, who has been working intensively for decades with a user-centered view on questions like these and has presented numerous publications on them.
In collaboration with John H. Falk, the conference "Connected Audience" takes place every two years in Europe for museum experts in research, practice and policy.
The last edition took place virtually in cooperation with the
”Institute for Research on Cultural Participation” and was dedicated to pressing issues of the public value and the relevance of museums.
John presented his latest publication "The Value of Museums: Enhancing Societal Well-Being" (2022), in which he spotlights the value and long-term effect of museum experiences.
We had a conversation with John. For us, he explains his findings and the linked pilot study.
Q. – How do museum visitors benefit from visiting a museum?
A. – “Museums have long believed, as well as claimed, that the visiting public derives significant benefits from their experiences. However, making good on these beliefs and claims has always been challenging. Over the past several years I have attempted to come up with a defensible, empirically grounded way for museums to substantiate these beliefs and claims.
In particular, after reviewing the past fifty years of visitor research data, as well as conducting additional research on museum visitors, I am comfortable in asserting that museums do indeed create significant value for their users.
Millions of people freely choose to visit museums with the expectation that they will gain something of value, and they are not mistaken.
Almost universally, people who visit museums leave satisfied and feeling like the experience has supported their needs and interests. Importantly, most visitors report that the benefits of their museum experiences lasted not just hours but often weeks, months, and in some cases decades, with typical benefits falling into one of the following four categories:
Personal – museums catalyze wonder, interest and curiosity. They also foster a greater sense of personal connectedness, appreciation, belonging and harmony with the human and natural world; all represent opportunities to reinforce identity and support a greater sense of personal purpose;
Intellectual – museums help people more clearly comprehend how their past understandings and activities connect, they inspire awe and appreciation for the best of human and natural creation, and under the best of circumstances, even serve as guides to a better, more informed and creative future;
Social – museums enhance many user’s sense of belonging to family, group and even community, and afford opportunities for people to support the needs and interests of others. As high-status institutions, museums bestow their users with a degree of both standing and respect; and,
Physical – museums (at least historically) are perceived as safe, healthy and restorative environments that allow people to gather (physically or virtually), interact, explore, play and enjoy without fear or anxiety.
All four of these types of outcomes represent forms of well-being. Museum-goers are not the only people seeking these four kinds of well-being-related benefits, and, of course, museums are not the only public institutions capable of providing these kinds of benefits. However, as described above, what makes museums such satisfying experiences for so many is that, overall, museum experiences seem to be particularly good at delivering these kinds of personal, intellectual, social and physical well-being-related benefits.
Q. – You refer to these benefits as being a form of enhanced well-being. Can you help us better understand what you mean by well-being?
A. – “Great question, I define well-being from an evolutionary perspective. Biologically speaking, well-being refers to the on-going and never-ending effort every human engages in to achieve balance – personal, intellectual, social and physical balance. Being in balance feels good, i.e., satisfying, being out of balance feels bad, i.e., unsatisfying.
The desire for well-being is both fundamental and universal, something every human in every cultural group, in every corner of the planet, strives for. Of course, every culture has viewed and described this pursuit of well-being differently, but each in its own way has incorporated the basic desire for well-being into their philosophies and daily lives.
Despite the pervasiveness of these well-being-related ideas and pursuits in all world cultures, it is surprising to discover how poorly this idea of well-being has been defined and studied by scientists.
Most problematic, is that most researchers seem to view well-being as a purely human, psychological phenomenon, and even more problematic, as a synonym for happiness or prosperity.
Although happiness and prosperity can be signs of well-being, neither adequately encompass the true depth and importance of well-being. The ability to perceive and act in ways that enhance well-being is actually not a recent human invention, but rather is an ancient and pervasive evolutionary survival strategy.
Humans, like all living creatures, constantly attempt to act in ways that maximize their positive well-being and minimize their negative well-being since being in balance is positively correlated with long-term evolutionary fitness. Living things able to positively affect this balance are, on average, more likely to be successful biologically and in human’s case, successful culturally as well.
From this perspective, maintaining a sense of well-being is not only a fundamental goal of life, but also a major motivational driver of (in our case, human) behavior – including behavior like the use of museums.
Thus, it is not surprising to discover that when people reflect back on their museum experiences, days, weeks and even years later, their descriptions of the benefits they derived, as above, fall within these four basic domains of human well-being, specifically the areas of enhanced Personal, Intellectual, Social and Physical Well-Being. What is surprising, though, is that historically, museum professionals have not fully appreciated this fact and thus have been unable to full capitalize on this insight. That is now changing.”
Q. - So, how can these ideas be used by museums?
A. – “Collectively, these ideas, as well as the emerging data that supports these ideas, enable museum practitioners to improve their practice in three key ways:
1) More effectively describe and defend the fundamental value museums create for the public.
2) Directly compare and evaluate the effectiveness of diverse museum experiences regardless of discipline, content and approach.
3) Create even better, more effective museum experiences for the public.
By framing the benefits of museum experiences in terms of universal, well-being-related human needs and aspirations, museum leaders should be able to more successfully argue that, with appropriate support, museums have the potential to support the basic needs of all citizens, and not merely the narrow esoteric needs of the few.
By reframing these outcomes in monetary terms, which this new approach also makes possible, museum leaders can not only describe the benefits of museum experiences in the language of policy makers, money, but do so in ways that demonstrate the highly cost-effective value of museum experiences, showing that the monetary value generated by a particular museum experience far exceeds the cost required to produce that experience.
Second, by creating a metric of value – enhanced well-being – that is independent of the specific content, e.g., art, science or history, or even the delivery mode of an experience, e.g., exhibition or program, live or virtual, museum leaders will be able to directly and objectively compare and contrast the actual costs and public benefits of their various offerings. In fact, should institutions choose to go there, this new approach could also open up the possibility for comparing and contrasting the relative efficacy of museum experiences between and across different institutions.
Finally, this re-framing of how to conceptualize the value of museum experiences has the potential to allow museum practitioners significantly greater ability to design and implement effective museum experiences. At the heart of this potential is an appreciation that exhibitions, objects, programs, films, websites, etc. are merely means to an end. The true value of museum experiences lies in how and by whom they are used; the true end goal of museums is to enhance societal well-being. Perhaps most importantly, these new insights create new opportunities and possibilities for how museums can create experiences that meet the well-being-related needs of ever larger proportions of the public, including and particularly those with less social and economic advantage.”
For more details see:
John H. Falk (2022). The Value of Museums: Enhancing Societal Well-Being
Dr. John Falk: "Defining and Measuring the Relevance of Museum: The Case for Enhanced Well-Being"
Contact:
john.falk@freechoicelearning.org
Feel free to share your opinion and experiences with us. We look forward to hearing from you.
Kind regards from the NORDMETALL-Foundation
Katja